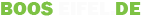Aktuelles
geschichtliches aus Boos
 Hier finden Sie Beiträge von Heimatforscher Horst-Dieter Stephani.
Hier finden Sie Beiträge von Heimatforscher Horst-Dieter Stephani.
- Details
- Horst-Dieter Stephani
- Zugriffe: 9970
In einem Amtsblatt vom August 1880 ist folgender Artikel veröffentlicht:
Am 15. Mai des Jahres 1880 ist in dem zur Landbürgermeisterei Mayen gehörigen Dorfe Boos ein Brand entstanden, welcher bei dem stark wehenden Nordostwinde so schnell um sich gegriffen hat, daß in ¼ Stunde 20 Wohnhäuser, 21 Scheunen und 21 Stallungen ein Raub der Flammen geworden sind. Außerdem sind 7 Stück Rindvieh, 1 Stute, 1 Fohlen und 9 Schweine verbrannt.
Die Gebäude waren bei der Rheinischen Provinzial-Feuer-Sozietät meistens sehr gering, die Mobilien nur in zwei Fällen versichert.
Der Gesamtschaden berechnet sich auf 62.640,- Mark, die Versicherungsentschädigung beträgt dagegen nur 40.148,- Mark, so daß die Beschädigten einen Verlust von 22.492,- Mark erleiden, welcher die betreffenden Familien um so empfindlicher betrifft, als dieselben meistens gering bemittelt und dazu noch mit 24.012,- Mark Schulden belastet sind.
Zur Unterstützung der Brandbeschädigten hat der Herr Oberpräsident der Rheinprovinz eine durch Deputierte aus der genannten Ortschaft bis zum 1. Dezember d. J. abzuhaltende allgemeine Hauskollekte bei den Bewohnern unseres Verwaltungsbezirkes und des Regierungsbezirkes Trier bewilligt, und zwar in unserem Verwaltungsbezirke mit Ausschluß derjenigen Ortschaften, in welchen zu dem fraglichen Zwecke bereits Sammlungen stattgefunden haben.
Zur Erhebung der Kollekte sind beauftragt worden:
Peter Schmitz, Mathias Schneider, Michael Schneider, Peter Molitor, Johann Molitor, Hubert Haubrich und Peter Simon, sämtlich aus Boos.
Koblenz, den 9. August 1880.
- Details
- Franz Josef Ferber
- Zugriffe: 25773
Aus dem Leben des “Eifeler Schinderhannes”, eines ehemaligen Schülers aus Boos
Von Franz Josef Ferber
Seine Herkunft
Johann Mayer, der spätere “Stumpfarm", ist im Bereich des heutigen Landkreises Daun geboren, nämlich in Uersfeld. Dies ist amtlich einwandfrei belegt, denn seine Geburt wurde unter der Nummer 41 des Standesamtsregisters am 5. April 1886 vom Standesbeamten in Kelberg wie folgt beurkundet:
“Vor dem unterzeichneten Standesbeamten erschien heute, der Persönlichkeit nach bekannt, die Hebamme Maria Catharina Mindermann, wohnhaft zu Uersfeld, katholischer Religion, und zeigte an, daß von der Anna Maria Knorr, katholischer Religion, Ehefrau des umherziehenden Tagelöhners Johann Wilhelm Mayer, katholischer Religion, wohnhaft früher zu Gunderath, jetzt ohne bekanntes Domicil zu Uersfeld in der Wohnung des Philipp Eberhard, am zweiten April des Jahres tausendachthundertachtzig und sechs, mittags um zwölf Uhr, ein Kind männlichen Geschlechts geboren worden sei, welches den Vornamen Johann erhalten habe ..."
Der Junge empfing die Taufe in der Pfarrkirche zu Uersfeld, nachdem er bereits am Tage seiner Geburt notgetauft worden war. Taufpaten waren Johann Schmitz aus Kaperich und Anna Bretz aus Nachtsheim. So steht es zu lesen im Taufbuch des katholischen Pfarramtes Uersfeld aus dem Jahre 1886.
Der Geburtsort Uersfeld war rein zufällig. Frau Mayer-Knorr hielt sich gerade hier auf, als die Zeit ihrer Niederkunft nahte. Bei dem Geburtshaus handelte es sich um das frühere “Leyendeckesch"-Haus in Uersfeld in der Hauptstraße (heute: Grundstück der Raiffeisenkasse). Die Geburtsstätte soll mündlicher Überlieferung zufolge die Scheune des Anwesens “Leyendeckesch" gewesen sein. Eine eigene Wohnung hatten die Eltern, jedenfalls zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes, nicht. Nachdem Frau Mayer das “Wochenbett" verlassen konnte, setzte sie mit dem Kind die Wanderschaft fort. Wohin überall ihre Wege führten, lässt sich heute nicht mehr mit Gewißheit sagen. Tatsache ist jedoch, dass sie sich späterhin in Boos (Kreis Mayen) niederließ und dort längere Zeit gewohnt hat.
Der Junge indessen wuchs heran. Er besuchte, vielleicht nicht regelmäßig, die Schule in Boos. Es lässt sich unschwer feststellen, dass er von Herrn Lehrer Johann Rausch unterrichtet wurde. Denn ein altes Schulfoto aus der Zeit um das Jahr 1899 zeigt Johann Mayer als etwa Dreizehnjährigen, hübsch gekleidet, ein Junge wie alle anderen. Niemand würde wohl auf den Gedanken gekommen sein, in ihm einen künftigen schweren Rechtsbrecher zu erblicken.
Dem Kindesalter entwachsen, musste Johann sich, wie dies für heranwachsende Menschen sozusagen natürlich war, sein Brot selbst verdienen. Dies fiel ihm wahrscheinlich schwerer als seinen Altersgenossen. Denn er hatte es zu Hause wohl kaum richtig gelernt. Trotzdem hat er zeitweise, soweit die Verhältnisse es erlaubten, durch seiner Hände Arbeit seinen Lebensunterhalt bestritten.
Im Mannesalter
Bereits im frühen Mannesalter hat Johann Mayer in einem Steinbruch gearbeitet. Dort soll auch das Missgeschick passiert sein, das vielleicht mitursächlich für seine spätere menschenverachtende Lebensweise wurde:
Er verlor bei Sprengarbeiten (oder beim Spielen mit Sprengstoff, wie da und dort behauptet wird) seinen linken Unterarm. Dieser Verlust brachte ihm den Spitznamen “Stumpfarm" ein. Seine späteren Arbeitgeber waren Bauern aus dem näheren Bereich, in dem er aufgewachsen ist, aber auch aus anderen Gebieten.
Irgendwann muss Stumpfarm den Bruch mit der Rechtsordnung vollends vollzogen haben. Wenn nicht alles täuscht, dann war dies etwa Mitte des Ersten Weltkrieges, also um das Jahr 1916, just zu jener Zeit, als er seine - vermutlich letzte feste - Arbeitsstelle verlor. Man bedenke: Stumpfarm war ein “Krüppel", für den Kriegsdienst nicht brauchbar und zum Arbeiten nur beschränkt verwendungsfähig. Von nun an hatte er auch keine dauernde Bleibe mehr. Er trieb sich vorwiegend in den Wäldern herum, übernachtete nicht selten in hohlen Baumstämmen und ernährte sich vom Wildfang. Trotz dieses unsteten Lebenswandels hat er seine mitmenschlichen Beziehungen keineswegs abgebrochen, im Gegenteil, er pflegte diese zum Teil ziemlich stark. Allerdings war der Personenkreis, zu dem er Kontakt unterhielt, merklich geschrumpft. Zum Kreis seiner Bekannten oder Freunde wären insbesondere zu zählen: Witwe Katharina F. aus Mannebach-Sickerath, Nikolaus Schüller aus Kalenborn (Kreis Cochem), Lorenz Reuter aus Masburg (Kreis Cochem), Maria Falk aus Bonn und schließlich Johann B. aus R., ein Deserteur aus der Zeit des Ersten Weltkrieges. Zu ihnen allen stand er längere Zeiten hindurch in engerer persönlicher Verbindung, bis sie - von einem Fall abgesehen - nach und nach Opfer seiner Grausamkeit wurden.
Seine Untaten
In den Notzeiten nach dem Ersten Weltkrieg zogen - wie dies auch nach dem Zweiten Weltkrieg geschah - so genannte Hamsterer aus den Städten über Land, um bei den Bauern allerlei Waren gegen notwendige Lebensmittel einzutauschen. Vielfach kamen die gleichen Personen in die gleichen Gegenden. Als eine solche “Hamsterin" war auch Frau Maria Falk anzusehen, die in Bonn wohnte und in gewissen Zeitabständen nach Mannebach und in die umliegenden Dörfer reiste. Bei einer solchen “Hamstertour" lernte sie auch den Stumpfarm kennen, was ihren sicheren Untergang bedeutete, wie sich herausstellen sollte. Die geschäftlichen Beziehungen gestalteten sich anfangs zur beiderseitigen Zufriedenheit. Frau Falk brachte bei ihren turnusmäßigen Besuchen dem Stumpfarm lebensnotwendige Dinge aus der Stadt mit. Dieser bezahlte mit Naturalien, genauer gesagt mit Wildbeute. Aus den Geschäftsbeziehungen soll sich, wie man wissen will, eine enge persönliche Verbindung entwickelt haben, die Frau Falk aber habe lösen wollen, als sie vom Vorleben ihres Bekannten erfuhr. Doch die Lösung der Freundesbande regelte der Stumpfarm selbst, allerdings auf seine Weise. Bei einem Spaziergang zwischen Masburg und Hauroth endete das Leben der Frau durch eine Kugel aus dem Gewehr ihres Freundes.
Auch zwei weiteren Personen machte der Stumpfarm den Garaus: Nikolaus Schüller aus Kalenborn und Lorenz Reuter aus Masburg. Beide gehörten, wie bereits erwähnt, zu seinem Freundeskreis oder - wie die Bevölkerung es nannte - zu seiner “Bande". Von Schüller ist bekannt, dass er sich von dem Stumpfarm absetzen wollte. In der Beziehung verstand dieser jedoch keinen Spaß. Er machte nicht viel Federlesens und erschoss beide Freunde heimtückisch zur gleichen Zeit und in der gleichen Gegend (in der Nähe von Reimerath-Boos). Die Leichen deckte er mit Reisig zu. Was anschließend geschah, ist an Scheußlichkeit kaum noch zu überbieten. Stumpfarm trennte den zwei Toten die Köpfe ab und vertauschte diese (!!). In der Tat: Man muss diesen Satz schon mehrmals gelesen haben, um ihn in seiner Tragweite zu begreifen. Und dennoch ist die Behauptung, wie sich noch zeigen wird, über jeden Zweifel erhaben.
Nikolaus Schüller wurde bei Reimerath, im Distrikt “Kant" gefunden, natürlich mit dem Kopf des Lorenz Reuter.
Lorenz Reuter wurde wesentlich später gefunden, und zwar im Arbachtal, etwa einen Kilometer nördlich der bereits genannten Franzen-Mühle, im Distrikt Etscheid (Staatsforst in der Gemarkung Boos), mit dem Kopf von Nikolaus Schüller.
In Sickerath, einem zur Gemeinde Mannebach gehörender Weiler, wohnte die Witwe Katharina F. Sie, die ihren Ehemann im Ersten Weltkrieg verloren hatte und mit ihren drei Kindern im Hause ihrer Mutter wohnte, war dem Stumpfarm sehr stark verbunden. Man sprach von intimen Beziehungen zwischen den beiden. Frau F. selbst hat aus ihrer Zuneigung zu dem Stumpfarm auch keinen Hehl gemacht. Gelegentlich sah man sogar beide gemeinsam zu einer Tanzveranstaltung nach Kelberg gehen. Sie versorgte ihren Freund mit Lebensmitteln, als er sich später vor dem Zugriff der Gendarmen in die Wälder zurückziehen musste. Bei den Beamten der Gendarmerie hat sie ihn schon mal als ihren Bräutigam bezeichnet. Das Elternhaus der Frau F. diente dem Stumpfarm lange Zeit als eigentlicher Unterschlupf. Frau F. war es auch, die ihren Freund in Schutz nahm, als eines Tages Gendarmeriebeamte erschienen und ihn verhafteten. Sie nahmen ihn am Schlafittchen und brachten ihn nach Virneburg, dem zu dieser Zeit für Mannebach zuständigen Amtsort; sie sperrten ihn im Spritzenhaus ein. Am selben Tage jedoch verschaffte er sich die Freiheit wieder. Man sah ihn gegen Abend, sein Gewehr auf dem Rücken, zum Hause seiner Freundin in Sickerath schreiten. Die Gastfreundschaft belohnte er mit Rehen und anderem Wild, das den Leuten in der damaligen Zeit verständlicherweise willkommen war. Durch die enge Verbindung zu dem Stumpfarm konnte es auf die Dauer nicht ausbleiben, dass die Frau von dessen unrühmlichem Vorleben erfuhr. Und gerade dieses (Mit-)Wissen wurde ihr, wie einigen anderen, zum Verhängnis. Als beim Stumpfarm die Erkenntnis reifte, seine Bekannte könnte ihm einmal gefährlich werden, stand sein Entschluss fest: er müsse sie umbringen. Es sollte sich hierzu auch bald eine passende Gelegenheit bieten. Frau F. hatte zu jener Zeit die Absicht, sich eine Ziege zu kaufen. Das tat sie ihrem Freund kund. Dieser wusste auch prompt einen Rat. In einem Ort bei Kaisersesch (Düngenheim), so erzählte er ihr, wisse er eine gute Ziege, die verkäuflich sei. Frau F., keinen Argwohn hegend, ging kurzentschlossen mit ihm. Von dieser Reise kehrte sie nie mehr heim. Ihr Freund Stumpfarm hatte sie auf dem Wege dorthin hinterrücks erschossen. Ihre Leiche wurde zwischen Illerich und Kaisersesch gefunden.
Man sieht: Stumpfarm mordete nicht wahllos, sondern zielstrebig. Dabei ging er mit einer äußerst gemeinen Hinterlist und einer erschreckenden Grobheit zu Werke. Er war stets sorgsam darauf bedacht, Mitwisser seiner Untaten zu beseitigen. Unbeteiligte Menschen dagegen ließ er im Grunde unbehelligt, zumindest tat er diesen kein Leid an.
Johann Wagner aus Boos, ein ehemaliger etwa gleichaltriger Mitschüler des Stumpfarms, machte sich eines Tages auf den Weg nach Salcherath (Gemeinde Retterath), um seinen dorthin verheirateten Bruder zu besuchen. Er machte nicht den weiten Fußmarsch über die Landstraße, sondern ging querfeldein. Sein Weg führte ihn schließlich durch ein größeres Waldstück. Als er dieses durchschritt, glaubte er plötzlich, seinen Augen nicht mehr trauen zu können. Auf einem Baumstamm saß, sein Gewehr in der Hand haltend, der weit und breit gefürchtete Stumpfarm. Dieser sprach zu ihm, offenbar hatte er die Erschrockenheit und Ratlosigkeit seines früheren Schulkameraden bemerkt: “Hast du Angst vor mir, Johann? Du brauchst vor mir doch keine Angst zu haben!" Und dann fuhr er fort: “Was erzählen die Leute von mir? Bring mir auf deinem Rückweg ein Brot mit und stelle es hier an den Baum!" - Wagner hat später auf seinem Heimweg von Stumpfarm keine Spur mehr gesehen.
Ähnlich erging es auch Nikolaus Hermann aus Lind, als er einmal zu Besuch in seinem Heimatdorf Mannebach weilte. Nachdem er abends zwischen zehn und elf Uhr zu Fuß den Heimweg angetreten hatte, begegnete ihm ausgangs des Dorfes der Stumpfarm. Doch dieser dachte nicht daran, dem Fremden Schaden an Leib und Leben zuzufügen, er ging wortlos an ihm vorüber. - Wie dargelegt, hat Stumpfarm seine engeren Freunde allesamt getötet. Sieht man einmal von Johann Simon (“Fritzjes Hännes", allerdings nicht mit Stumpfarm befreundet gewesen), einem Gastwirt aus Mannebach, dem der Stumpfarm eine Zeit lang nach dem Leben trachtete, ab, so ist ihm dies in einem einzigen Fall nicht gelungen. Johann B. aus R. überlebte den Stumpfarm, obgleich er, mit diesem jahrelang eng vertraut, es mit Erfolg gewagt hatte, die Freundesbande zu zerbrechen. Kann man annehmen, dass Stumpfarm seinen langjährigen Freund Johann B. von dem Schicksal der übrigen Freundeskreismitglieder ausnahmsweise verschonen wollte? Bestimmt nicht! Auch B. stand auf der “Abschussliste", was daraus hervorgeht, dass er einmal in einer hellen Mondnacht bei Salcherath aus weiterer Entfernung beschossen wurde. Welcher Umstand ihn vor dem Erschießungstod bewahrte, wird sich heute kaum mehr genau erkunden lassen. Leute, die beide persönlich gekannt haben, meinen, dass Stumpfarm, nach übereinstimmenden Schilderungen seiner Zeitgenossen ein mittelgroßer, etwas schmächtiger Mann, dem Johann B., kräftiger von Gestalt, körperlich - aber höchstwahrscheinlich auch geistig - nicht gewachsen war. Diese Unterlegenheit wurde dem Stumpfarm letzten Endes zum Verhängnis. Dadurch blieb der Belastungszeuge im Strafprozess, als der Johann B. (nach eigener Aussage) später auftrat, erhalten. Kein Wunder also, dass Stumpfarm bei seiner Festnahme bedauernd feststellte, er habe “einen zu wenig umgelegt".
Unter solchen Umständen könnte man seine verbrecherischen Handlungen mit dem Dichterwort umschreiben: “Ist dies schon Tollheit, hat es doch Methode.” Nachträglich betrachtet, mag die zunehmende Angst in der Bevölkerung, besser gesagt bei jenen, die mit dem Stumpfarm nichts zu tun hatten, unbegründet gewesen sein. Verständlich war sie allemal. Schließlich pflegte der Furcht und Entsetzen einflößende Mann mit dem Leben seiner Mitmenschen nicht gerade zimperlich umzugehen. Eine damals allgemein gebräuchliche Verhaltensregel lautete: “Pass auf, dass dir der Stumpfarm nicht begegnet!"
Sein Ende
Im Sommer des Jahres 1922 konnten die Menschen aufatmen. Stumpfarm war gefasst worden. Die Kunde hiervon verbreitete sich wie ein Lauffeuer; auch die Umstände seiner Gefangennahme: Bei dem Dorf Eulgem in der Nähe von Kaisersesch, stieß Stumpfarm auf eine Landfahrersippe, von der er Feuer für eine Zigarette erbat. Vor ihr glaubte er sich einigermaßen sicher fühlen zu können. Doch seine Hoffnungen trogen. Das “fahrende Volk" war über ihn bestens informiert, stand es doch allerorten zu lesen, dass Stumpfarm gesucht werde und dass auf seine Ergreifung eine hohe Belohnung ausgesetzt sei. Im Handumdrehen war er von den fremden Leuten überwältigt. Die Gendarmen erschienen, nahmen ihn fest an die Kandare und brachten in nach Kaisersesch zur Wache. Diesmal gab es kein Entkommen mehr wie damals in Virneburg. Von Kaisersesch aus ging die Fahrt mit der Eisenbahn über Andernach nach Koblenz. Dort wurde ihm der Prozess gemacht.
Die Lebensweise des Stumpfarms ist nicht in allen Teilen mit der seiner Vorgänger vergleichbar, wenngleich einige Gemeinsamkeiten zu verzeichnen sind. Allen gemeinsam ist vornehmlich dies: ihre außerordentliche kriminelle Energie und - ihr Ende. Wie bei Bückler, Esuk und Schiffmann war bei Johann Mayer, zu dieser Zeit 37 Jahre alt, Endstation seines (zeitweiligen) Verbrecherdaseins das Fallbeil. Das Todesurteil, welches das Schwurgericht Koblenz am 7. Februar 1923 gesprochen hatte, ist am 29. Dezember des gleichen Jahres vollstreckt worden. Der zuständige Oberstaatsanwalt hat dies der Öffentlichkeit am 29. Dezember 1923 mit folgenden Worten bekannt gemacht:
“Die gegen den Tagelöhner Johann Mayer, genannt “Stumpfarm", ohne festen Wohnsitz, durch rechtskräftiges Urteil des Schwurgerichts Koblenz vom 7. Februar 1923 wegen Mordes, begangen in der Gegend zwischen Masburg und Hauroth an der Ehefrau Maria Falk aus Bonn, in der Gegend von Reimerath oder Boos an Nikolaus Schüller aus Kalenborn und Lorenz Reuter aus Masburg und in der Gegend zwischen Illerich und Kaisersesch an der Witwe Katharina F.... aus Mannebach, erkannte Todesstrafe, ist an dem Verurteilten heute in Köln durch Enthauptung vollzogen worden."
Die Kunde von der Hinrichtung wurde weit verbreitet. Nicht nur in den Kölner Zeitungen wurde hierüber berichtet, sondern auch die hiesigen Zeitungen enthielten entsprechende Notizen. So war beispielsweise in der früheren “Eifeler Landeszeitung" vom 19. Januar 1924 (Druck und Verlag: Buchdruckerei F. Werner, Daun) zu lesen:
“Morgens gegen 1.27 Uhr wurde im Strafgefängnisse Klingelpütz in Köln der Knecht Johann Mayer ... wegen 5fachen Mordes durch den Scharfrichter Heck aus Magdeburg mittels Fallbeil hingerichtet. Mayer war vom Schwurgericht in Koblenz viermal wegen Mord zum Tode und einmal wegen Totschlag zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt worden. Der fünffache Mörder hatte seine Untaten vor Gericht nicht eingestanden, legte jedoch kurz vor der Hinrichtung ein Geständnis ab. Er starb als reuiger Sünder und empfing vor seinem Tod noch die Sterbesakramente der kath. Kirche."
Im Verlaufe der Zeit ist es still geworden um den Stumpfarm. Unseren Zeitgenossen erscheint er nach einem Menschenalter mehr als Figur einer bösen Legende denn als Wirklichkeit. Der Wanderer, den es in die anmutigen Täler des Nitzbaches und des Arbaches zieht, ahnt nichts von den menschlichen Tragödien, die sich einstmals in diesem landschaftlich reizenden Raum abgespielt haben. Hier, fernab der Hauptverkehrsstraßen, findet er etwas von dem, was man auch dem Stumpfarm zeitlebens gewünscht hätte, was ihm aber - Gott sei`s geklagt - nicht vergönnt war: innere Ruhe und Frieden
- Details
- Horst-Dieter Stephani
- Zugriffe: 8429
Der mitanwesende Oberbausekretär Schlich vom Kreisbauamt in Mayen erstattete dem Gemeinderat ausführlichen Bericht über den Stand der Planungsarbeiten für den Wasserleitungsbau, insbesondere in Gewissheit des Gemeinderatsbeschlusses vom 24. Januar 1924 über das Angebot der Firma Fr. W. Langenbach in Ehrenbreitstein zur Ausführung der Arbeiten.
Nach den Ausführungen des Oberbausekretärs Schlich ist das Angebot der genannten Firma ein durchaus angemessenes und günstiges. Der Gemeinderat erklärt sich daher mit dem Angebot einverstanden und beauftragt das Kreisbauamt nach dem Beschluss vom 24. Januar 1924, den Vertrag mit der Firma sofort abzuschließen und mit den Arbeiten unverzüglich zu beginnen.
Weiter beschließt der Gemeinderat, die Zapfhähne insgesamt zu bestellen und, wenn die Gemeindemittel ausreichen, jedem Hauseigentümer einen Zapfhahn aus Mitteln der Gemeinde zu bestellen. Der Gemeinderat schlägt vor, die Bachunterführung, z.B. in der Kehr, zu umgehen und die Leitung, statt mit dem Wege, neben dem Wege an den Rand der Wiese zu verlegen.
Diese Anregung soll bei Ausführung der Arbeiten von der Bauleitung berücksichtigt werden.
Der Vorsitzende
Schaaf
Bürgermeister
v. g. U. Theisen, Haubrich
Faßbender, Schneider, Zimmer, Simon.
- Details
- Horst-Dieter Stephani
- Zugriffe: 8601
Wie urkundlich und genehmigungsrechtlich bekannt ist, befand sich Ende des 19. Jahrhunderts noch bei Boos ein Bleierzbergwerk in Betrieb.
Am 7. Dezember 1869 wurde dieses Bergwerk, welches den Namen “Jung 1" hatte, vom königlichen Oberbergamt in Bonn dem Kaufmann Wilhelm Münzel aus Mayen verliehen, der damit auch die Schürfrechte besaß.
Aus der Beschreibung der Bergreviere Koblenz 1883 von Wilhelm Liebering geht nur eine geringe geologische Beschreibung hervor:
Von Gängen, welche vorzugsweise Zinkerze, hiermit verwachsen aber auch Blei- und Kupfererze führen, ist hier nur ein einziger bekannt.
Er setzt westlich des Schlackenkegels Hochsimmer auf und wird in der Grube “Silbersand" bebaut.
Sein Streichen ist h. 3 - 4 und das Einfallen unter 60 - 65 Grad in Südost.
Ungefähr im Streichen dieses Ganges nach Südwesten ist in den Grubenfeldern Johann bei Kürrenberg, Jung 1 bei Boos und Kempen bei Mannebach ein Vorkommen von derben Bleierzen aufgeschlossen, welches vielleicht mit dem Silbersander Gang bei Mayen in Zusammenhang steht.
Wir wissen nach mündlicher Überlieferung und Erzählungen unserer Eltern und Großeltern, dass sich das Booser Bergwerk im “Hexentanz" befunden hat, und wer es weiß, erkennt heute noch im Wald die Konturen des abgedeckten Stolleneinganges und die Gräben für die Transportwege zum Tal hinab.
Es ist ebenfalls überliefert, dass zur Blütezeit der Gruben und Hütten in der Eifel im Jahre 1756 eine Huldigungsreise des Erzbischofs und Kurfürsten Johann Philipp zu Trier stattfand.
Die Reise des Landesherrn führte u.a. von Koblenz aus über Mayen, Kelberg nach Hillesheim, wo er zwischendurch sämtliche Bergwerke und Gruben besichtigte. Sollte der Kurfürst damals auch das Bergwerk Jung 1 in Boos besichtigt haben, wo er ja auf dieser Route durchreisen musste?
Die schlechten Verkehrsverhältnisse und Transportmöglichkeiten zur damaligen Zeit und zumal in unserer Region (man bedenke, es gab weder Lkw noch die Bahn und somit muss das gewonnene Material mindestens mit Pferdefuhrwerken bis zum Weitertransport an die nächste Wasserstraße, den Rhein oder die Mosel, gebracht worden sein oder zur Verarbeitung in die Industriestädte), dazu der geringe Wert der gewonnenen Materialien mögen wohl viele der Unternehmer dazu bestimmt haben, nach etlichen Jahren des Versuchens die Sache völlig aufzugeben!
Aus einem Schreiben eines Bergwerks-Betriebsführers i.R. an die Firma Münzel in Mayen (welches wir natürlich im Original aus verständlichen Gründen nicht veröffentlichen) geht hervor, dass die AG des Altenbergs, Abt. Grube “Bendisberg" zu Virneburg, im April 1952 von der Firma Münzel die nochmaligen Schürfrechte für diese stillgelegte Grube beantragt hatte.
Es ist somit anzunehmen, dass hier noch immer Bleierze in der Grube “Jung 1" im Hexentanz angenommen werden und auf weitere Ausbeute warten.
- Details
- Horst-Dieter Stephani
- Zugriffe: 7389
Das Dorf Boos zählt seit seiner Erstbesiedlung zu den urtümlichen Bauerndörfern der Eifel. Haupterwerbsquelle natürlich, wie überall in den ländlichen Bezirken, war die Landwirtschaft.
Bereits die Kelten und Germanen betrieben Ackerbau zum Überleben. Aus dieser Landwirtschaft muss dieser Ort auch entstanden und begründet sein, spricht man doch bereits bei der ersten urkundlichen Erwähnung von einem “Ackergrundstück”bzw. einem “Gut" zu Boos, und auch im späteren Mittelalter, unter der Herrschaft der Grafen und Kurfürsten, ist die Rede von den “Burghöfen" zu Boos und von den “kurfürstlichen Höfen" zu Boos.
Außerdem betrieben viele Bürger über Jahrhunderte hinweg Kohlenbrennereien in den umliegenden Wäldern. Diese Brennstellen finden wir teils heute noch im Staatswald Etscheid, erkenntlich durch kreisrunde Bodenvertiefungen mit kohlschwarzer Erde.
Außer der Landwirtschaft verdienten sich noch unsere Großväter im Herbst und Winter durch Waldarbeit etwas zu ihrem kargen Lebensunterhalt hinzu. Die Frauen und Mädchen hatten dazu die Möglichkeit, als Waldarbeiterinnen beim Pflanzen und Kultivieren ein paar Groschen zu verdienen.
Weitere Erwerbsmöglichkeiten für die Männer wird wohl im 18. oder 19. Jahrhundert das Bleierzbergwerk zwischen Boos und Münk gegeben haben. Die Booser Gemarkungen waren auch strukturell sehr beeinflusst durch die beiden Vulkanausbrüche Ober- und Unterschemel, sodass überall reichlich Lava, Basaltstein und Tuffstaub vorhanden war, wodurch zahlreiche Steinbrüche und Sandgruben rund um Boos betrieben wurden, die den hart darin arbeitenden Männern auch viel Schweiß, aber geringen Lohn erbrachten. Ein Vorteil bestand schon für die Bürger von Boos durch diese eigenen Steinbrüche und Lavagruben, denn diese Bodenschätze konnten sie für ihren eigenen Haus- und Hofbau verwenden.
Fleißige und tüchtige Handwerksleute und eigenständige Betriebe gab es in Boos bereits im 19. Jahrhundert.
Bekannt sind u.a. etliche Schmiede, die viele Generationen zurückreichen; auch der Beruf Nagelschmied wurde in Boos ausgeübt.
Dazu kamen die Stellmacher, die Wagner (Wagenbauer), die Schreinerbetriebe, Schuster, Gerberei, Schneider, Bäckereien und Krämerläden.
Nicht zu vergessen die umliegenden Mühlen, die sowohl im Nitztal, im Eschbachtal, im Mimbachtal und an der Arbach auf alte Traditionen zurückblicken können.
Im 20. Jahrhundert, als die ersten Kraftfahrzeuge gewerblich eingesetzt wurden, entstanden in Boos bereits die Fuhrunternehmen.
Mit der Molkerei kam dann sogar Industrie ins Dorf, wo auch viele Booser Männer und Frauen bereits ihre hauptberufliche Anstellung erhielten.
Mit der Bimsindustrie in der Pellenz eröffnete sich für manchen Booser Bürger eine harte, aber weitere Verdienstmöglichkeit, indem man sich dort bei der Herstellung der so genannten “Blocksteine” oder auch bei der Rohmaterialausbeutung betätigte.
Die Kleinbauern in Boos gaben in den 70er Jahren immer mehr ihre Betriebe auf, da diese Art Landwirtschaft immer weniger Rendite brachte. Großbetriebe und Siedlungen konnten sich nur noch bei der wachsenden Agrarkonjunktur mit dem Ackerbau und der Viehzucht gewinnträchtig etablieren. Somit gibt es heute in Boos nur noch einige wenige hauptberufliche Landwirte und nur noch sehr, sehr wenige Milchkühe. Demgegenüber hat sich aber in Boos in den 60er und 70er Jahren Industrie angesiedelt, sodass heute viele Booser Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit haben, in ihrem Heimatort bei der Herstellung von Waren handwerklich und kaufmännisch ihren Lebensunterhalt zu verdienen.